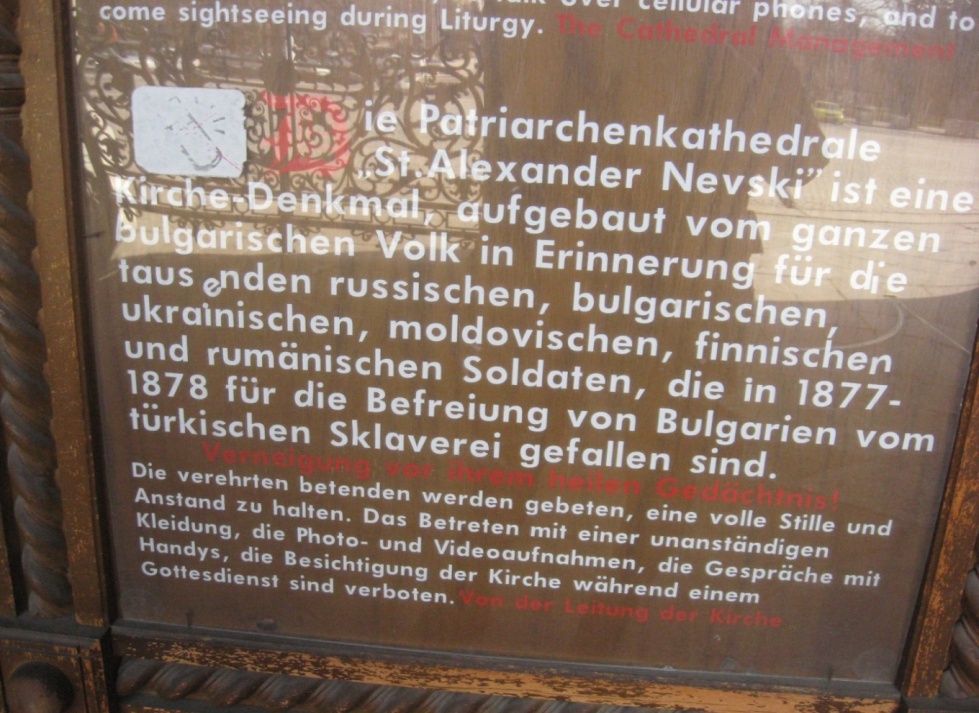(Michael Meißner) Esma Redžepova zählt zu den bekanntesten Künstlern Mazedoniens, wenn nicht sogar des kompletten Balkanraums. Seit über 50 Jahren ist sie auf den Konzertbühnen der Welt unterwegs und setzt sich für die Interessen der Roma ein.

Aufgewachsen in einem Roma-Viertel in Skopje, der Hauptstadt Mazedoniens, war ihr kosmopolitisches Denken fast schon in die Wiege gelegt. Ihre Urgroßmutter väterlichseits war irakische Jüdin, ihr Urgroßvater ein katholischer Roma. Beide zogen aus Albanien über das Kosovo nach Skopje. Die Familie von Esmas Mutter war muslimisch mit türkisch-serbischen Wurzeln.
Esma hatte das Glück, das ihre Mutter die musikalischen Talente ihrer Tochter förderte und ihr Bruder sie frühzeitig bei einer Roma-Musikorganisation anmeldete. Zu diesem Zeitpunkt war Esma neun Jahre alt. 1957, im Alter von dreizehn Jahren, gewann sie einen Talentwettbewerb bei Radio Skopje. Es sollte ihr Leben nachhaltig verändern.
Bereits ein Jahr zuvor hatte sie das Lied Čaje Šukarije geschrieben, welches sich 1959 zum Hit im ehemaligen Jugoslawien entwickelte und bis zum heutigen Tage zu ihrem Stammrepertoire gehört.
Esma Redzepova – Caje Sukarije
Nur wenig später gelang ihr mit Romano Horo ein weiterer Erfolg, der zum Klassiker avancierte. Der Song stellte eine Antwort auf den damals populären Twist dar.
Zu diesem Zeitpunkt arbeitete sie schon als fest engagierte Sängerin des Ensembles Teodosievski. Deren Bandleader, Namensgeber und spätere Ehemann von Esma, Stevo Teodosievski, hatte sie beim Talentwettbewerb singen gehört und sich bei ihrem Vater für eine musikalische Ausbildung und Karriere des jungen Roma-Mädchens eingesetzt.
1961 trat Esma als erste weibliche Roma im jugoslawischen Fernsehen auf und durfte für eine weltweite Tournee ihr sozialistisches Heimatland verlassen – in der damaligen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Spätestens ab diesem Zeitpunkt ging es mit ihrer Karriere steil bergauf, sowohl national als auch international.
Das von ihr 1971 beim ersten Romani Congress in London vorgetragene Lied „Djelem, Djelem“ wurde zur weltweiten Hymne der Roma deklariert. Beim Weltmusikfestival der Romani-Lieder und –musik 1976 im indischen Chandigarh, erhielt Esma den Titel Königin der Roma-Musik zugesprochen.
Djelem, Djelem [1]
Ich wanderte die langen Straßen entlang.
Ich traf glückliche Roma.
Ich wanderte die Straßen entlang.
Ich traf glückliche Roma.
Oh Roma, oh Jugendzeiten.
Oh Roma, oh Jugendzeiten.
Oh Roma, wo kommt ihr her
Mit euren Zelten auf glückbringenden Straßen?
Auch ich hatte eine große Familie.
Sie wurde von der Schwarzen Legion ermordet.
Kommt mit mir, Roma dieser Welt.
Ihr, die ihr die Roma Straßen erschlossen habt.
Die Zeit ist gekommen, erhebt euch Roma.
Wenn wir uns erheben, dann werden wir Erfolg haben.
Oh Roma, oh Jugendzeiten
Oh Roma, oh Jugendzeiten
In ihrer gesamten Karriere hat sie über 15.000 Konzerte absolviert, von denen 2.000 für humanitäre Zwecke waren. Sie blickt mittlerweile auf eine Discographie von 1.000 Songs und 586 veröffentlichten Tonträgern zurück. Esma erhielt zwei Platin-, acht Goldene und 8 Silberne Schallplatten. Ihr Album „Queen of the Gypsies“ zählt weltweit zu den Top 20 im Bereich World Music.
Zugleich scheut sie sich nicht, moderne Produktionen mit ihrem Gesang einen besonderen Stil zu verpassen. Dazu zählt die Zusammenarbeit mit dem Komponisten und Musiker, Kiril Džajkovski.
Darüber hinaus begründet sich Esmas Ruf vor allem auf ihrem humanitären Engagement. Schon 1963 nach dem verheerenden Erdbeben in Skopje, veranstaltete sie 50 Konzerte, um Geld für die Opfer zu sammeln. Sie und ihr Mann adoptierten im Laufe der Jahre 47 Roma-Kinder und ermöglichten ihnen eine Ausbildung. Sechs davon unterstützen Esma bei den Konzerten in ihrer Live-Band.

Zeit ihres Lebens spendete sie sehr viel Geld für humanitäre Zwecke und auch jetzt noch dient ein großer Teil ihrer Konzerterlöse der Unterstützung verschiedenster Organisationen. Esma war zudem an der Gründung der ersten multiethnischen Partei Mazedoniens, der Demokratischen Alternative, beteiligt.
Für ihr Engagement wurde sie zweimal für den Friedensnobelpreis nominiert (2002 & 2003). Sie erhielt den Mutter-Teresa-Preis 2002, wurde zur Roma-Frau des Jahrtausends gekürt und ist Ehrenpräsidentin des mazedonischen Roten Kreuzes. Die weiteren Auszeichnungen würden den Rahmen des Beitrages sprengen.

Esma ist weiterhin aktiv, nimmt Songs auf und reist für Konzerte um die Welt.
Lassen wir uns überraschen.