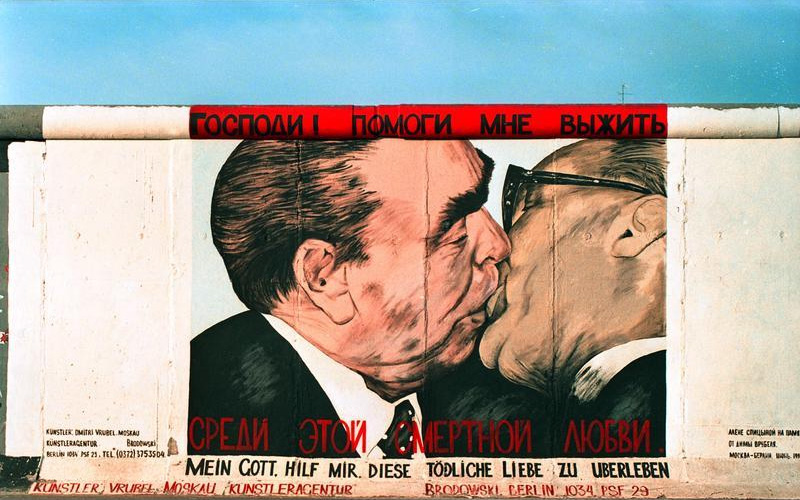(Kristin Kretzschmar)
In der Vorbereitung einer Rucksacktour befindet man sich irgendwann an dem Punkt, dass man zwischen T-Shirt und Reiseliteratur abwägen muss. Jedes Gramm im Rucksack will ja auch getragen werden. Ich war zwei Stunden vor Abreise an diesem Punkt: sollte ich Seneca – Das Leben ist kurz oder ein weiteres Trekking Shirt einpacken? Seneca hat gewonnen. Wie sich später herausstellte, war das auch gut, denn Bücher sind unter Rucksacktouristen beliebte Tauschmittel.

Im Sommer 2012 machte ich mich von Berlin auf, um Südosteuropa zu bereisen. Einen genauen Plan hatte ich nicht, aber einige Anhaltspunkte: das Guca Festival, das Retezat-Gebirge, Cluj-Napocca, Tetovo und Tiraspol. In zwei Monaten sollte das alles zu machen sein. Mein Plan war es auf Reiseführer zu verzichten. Lieber wollte ich mir von anderen Reisenden und Einheimischen die Highlights empfehlen zu lassen. Außerdem habe ich mich auch gegen die Rail Way Pässe entschieden: Das wahre Leben findet man abseits der Schiene.
Ende Juli machte ich mich auf den Weg nach Belgrad, wo das große Abenteuer beginnen sollte.
In den folgenden Berichten, möchte ich meine Tour für LerserInnen nacherlebbar machen. Dabei liegt der Fokus nicht auf den Sehenswürdigkeiten und Jahreszahlen, denn hierbei könnte ich weder Vollständigkeit in Anspruch nehmen, noch wäre der Mehrwert vorhanden: Es gibt zahllose Wikis mit Reiseinformationen. Vielmehr geht es um meine individuellen Eindrücke und Erfahrungen.
Während der Reise stieß ich auf verschiede wiederkehrende Motive, die sich auch in mehreren der Berichte finden. So traf ich auf viele (ehemalige) Gastarbeiter. Diese erzählten nicht ohne Stolz wo sie in Deutschland gearbeitet haben und präsentieren ihre Deutschkenntnisse. Des Weiteren stieß ich durchgängig auf grenzenlose Gastfreundschaft. Zunächst nutzte ich Couchsurfing, um in Städten Unterschlupf zu finden. Auf dem Land, wo Couchsurfing nicht so verbreitet ist, wollte ich zelten. Doch oft war mein Zelt unnötig, da mich Einheimische in ihr Haus einluden. Ein weiteres bestimmendes Motiv war „das weltweit beste Quellwasser„. In ihrer grenzenlosen Gastfreundschaft teilten die Einheimischen ihre wertvollsten Güter: Gemüse aus dem Garten, zeigten mir die Trinkwasserquellen im Felsen (stets mit dem Hinweis, es sei das beste Wasser und irgendein großer Konzern möchte es bald kommerziell nutzen) und natürlich auch den daraus gebrannte Rakia und Palinka. Ein Weiteres Motiv war die Musik. Zunächst war eines der geplanten Ziele das Guca Festival, um mich hier von den Klängen des Balkans verzaubern zu lassen. Doch auch abseits des Festivals traf ich immer wieder auf einheimische Musiker.
Letztendlich reiste ich etwa 4500 km, einige Anhaltspunkte bietet die Karte. In meherern Teilen werde ich in den nächsten Wochen von den einzelnen Zielen berichten.